| Motivation
Welchen Wert haben IT-Investitionen für Unternehmen?
Wie kann der Nutzen von IT-Investitionen gemessen werden und
welche Methoden sind zur Wirtschaftlichkeitsanalyse von IT-Investitionen
geeignet? Im Informationszeitalter haben diese Fragestellungen
entscheidende Bedeutung für das IT-Management. Die Forderung
nach Wirtschaftlichkeitsanalysen für IT-Investitionen als
Forschungsbereich existiert bereits seit Anfang der achtziger
Jahre mit den ersten organisationsweiten und infrastrukturähnlichen
Einführungen von Informationstechnologien in Unternehmen.
Während der neunziger Jahre trat die wirtschaftliche Analyse
von Informationstechnologien durch den strategischen Fokus
auf Expansion und Wachstum in den Hintergrund. Der Niedergang
der New Economy zur Jahrtausendwende und die damit verbundene
Kapitalrestriktion haben der Diskussion über Wirtschaftlichkeitsanalysen
von IT-Investitionen in den letzten Jahren einen neuen Aktualitätsbezug
gegeben. Dabei wird nach der euphorischen Phase über die Möglichkeiten
von Informationstechnologien zunehmend die Wirtschaftlichkeit
von IT-Investitionen kritisch hinterfragt. Volkswirtschaftliche
Argumentationen stellen sogar den strategischen Nutzen der
Technologieführerschaft bei IT-Investitionen generell in Frage.
Zu den Erfahrungen der New Economy mischen sich Meldungen
über den hohen Anteil gescheiterter IT-Projekte, welche die
Forderung nach wirtschaftlichen Analysen von IT-Investitionen
verstärken. Es besteht in der Praxis eine hohe Verunsicherung
über die Wirtschaftlichkeit von IT-Investitionen, da unabhängige
quantitative Analysen oder empirische Studien über die Wirtschaftlichkeit
von IT-Investitionen nicht existieren und eine allgemeingültige
Aussagefähigkeit anwendungsfallspezifischer Studien nicht
möglich ist. Welche IT-Investitionen sich lohnen, ist zurzeit
eine der meist diskutierten Fragestellungen in der Praxis,
in Fachbeiträgen und auf Konferenzen.
Probleme bei der Wirtschaftlichkeitsanalyse?
Die Wirtschaftlichkeitsanalysen von IT-Investitionen stellen
für viele Unternehmen im IT-Sektor ein konkretes Problem dar.
Viele Autoren haben in der Literatur auf das Versagen der
klassischen Investitionsrechnungsverfahren hingewiesen. Es
treten insbesondere folgende Probleme auf:
Problematische Quantifizierung des Nutzens: Die Prognose
der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung von IT-Investitionen
ist problematisch. Insbesondere die Nutzenseite der IT-Investition
ist schwierig abschätzbar. Die Nutzeneffekte von IT-Investitionen,
die zwar feststellbar jedoch nicht oder nur schwer zu quantifizieren
sind, werden in Praxis und Literatur mit folgenden Begriffen
bezeichnet:
• qualitativer Nutzen • strategischer Nutzen • indirekter
Nutzen • intangibler Nutzen • diffuser Nutzen • weicher Nutzen
•
Es existiert im Bereich der Wirtschaftlichkeitsanalysen für
IT-Investitionen keine einheitliche Definition der oben genannten
Begriffe, sie werden meistens synonym verwendet und durch
Beispiele beschrieben wie höhere Kundenzufriedenheit, höhere
Mitarbeiterzufriedenheit, schnelleres Reaktionsvermögen des
Unternehmens, besseres Unternehmensimage etc. Diese Nutzenkategorien
lassen sich äußerst schwierig in monetären Beträgen ausdrücken.
Tam stellt in seiner Untersuchung fest, dass in der Praxis
Probleme auftauchen, die Zahlungsströme einer IT-Investition
zu bestimmen. Die Standardmethoden zur Evaluierung von IT-Investitionen
können nur mit Einschränkungen angewendet werden.
Negative Wirtschaftlichkeitsanalysen: Die problematische
Quantifizierung der Nutzeneffekte führt zu einer Asymmetrie
in der Berücksichtigung von Kosten und Nutzen. Die Kosten
von IT-Investitionen lassen sich relativ einfach quantifizieren,
da für Anfangsinvestition und Folgekosten sowohl Marktpreise
als auch Aufwandsabschätzungen bestehen, während viele Nutzenpotenziale,
insbesondere der weiche Nutzen, nicht quantifizierbar sind.
Die entstehenden Kalkulationen sind damit nicht mehr ausgewogen.
Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für IT-Investitionen fallen
daher bei der Beurteilung oftmals negativ aus.
Verlust der Glaubwürdigkeit und
Akzeptanz: Die problematische Quantifizierbarkeit der intangiblen
Nutzeneffekte verleitet viele Unternehmen dazu, diejenigen
Potenziale überzubewerten, die leicht zu quantifizieren sind,
um schon frühzeitig auf positive Investitionswerte zu kommen.
Viele Nutzenbetrachtungen sind unglaubwürdig, die Ergebnisse
von Wirtschaftlichkeitsanalysen werden von Verantwortlichen
im Management und Controlling oftmals nicht akzeptiert.
Gefahr strategischer Fehlentscheidungen: Die problematische
Quantifizierung der Nutzenpotenziale führt bei einer kaufmännisch
vorsichtigen Bewertung zu einer systematischen Unterbewertung
der IT-Investitionen. Dies kann zu strategischen Fehlentwicklungen
führen, besonders in großen Unternehmen und Organisationsformen,
wo Investitionsentscheidungen zur Rationalitätssicherung nur
über den Beitrag der IT-Investitionen zum Unternehmenswert
gesteuert werden. Es besteht die Gefahr, dass strategisch
wichtige Investitionen routinemäßig abgewiesen werden. Unternehmen
können somit enorme Potenziale und strategische Vorteile verlieren.
Faustregeln und Intuition als Entscheidungsgrundlage:
Viele Unternehmen treffen aufgrund der Quantifizierungsproblematik
und der negativen Wirtschaftlichkeitsrechnungen strategisch
wichtige Entscheidungen kaum mehr auf der Basis einer rationalen
Entscheidungssicherung oder auf der Basis allgemein anerkannter
betriebswirtschaftlicher Messgrößen. Stattdessen werden oftmals
Intuition und Erfahrung als Entscheidungsgrundlagen genutzt.
Weill, Crnkovic und Holstein fanden in ihren Untersuchungen
verschiedene Faustregeln wie ‚invest to keep up with the technology’,
‚invest, if your competitors invest’ oder ‚we have to invest,
don’t worry about the payback’, welche als Entscheidungsgrundlage
dienen.
Warum Wirtschaftlichkeitsanalysen?
Wirtschaftlichkeitsanalysen
machen die Erfolgs- und Kosteneinsparungspotenziale verschiedener
IT-Investitionen qualitativ oder quantitativ messbar. Sie
bilden eine Basis für die Beurteilung einzelner IT-Investitionen
und ermöglichen eine Vergleichbarkeit von verschiedenen Investitionsalternativen.
Ihre besondere Bedeutung lässt sich auf folgende Merkmale
der IT-Investitionen zurückführen:
IT-Investitionen sind kostenintensiv:
Die Kosten für IT-Investitionen unter Berücksichtigung der
Folgekosten bewegen sich in Größenordnungen von mehreren Millionen
Euro. Angesichts der hohen Kosten werden bei IT-Investitionen
Wirtschaftlichkeitsanalysen zur Sicherstellung einer rationalen
Unternehmenssteuerung gefordert. Derartige Anforderungen an
ein spezifisches Mindestmaß an Wirtschaftlichkeit finden sich
teilweise explizit in den Bestimmungen zur Konzernsteuerung
und Unternehmensführung. Wirtschaftlichkeitsanalysen schaffen
Transparenz über den Wertbeitrag einer IT-Investition zum
Unternehmen.
IT-Investitionen sind irreversibel:
IT-Investitionen sind mit der Umstellung von Unternehmens-
und Geschäftsprozessen verbunden. Der außerordentliche Anpassungsaufwand
von innerbetriebli-chen und überbetrieblichen Abläufen macht
IT-Investitionen irreversibel, sobald die Implementie-rung
abgeschlossen ist. Eine genaue ökonomische Analyse von IT-Investitionen
ist unter den gegebenen organisatorischen und politischen
Herausforderungen geboten.
IT-Investitionen haben unternehmensweite
Auswirkungen: Viele Potenziale von IT-Investitionen lassen
sich nur bei einer organisationsweiten Einführung nutzen,
da Informationen an verschiedenen Stellen im Unternehmen und
nur in vernetzter Form existieren. Dieser funktionsübergreifende
Einsatz von IT-Investitionen hat unternehmensweite Auswirkungen.
Wirtschaftlichkeitsanalysen schaffen Transparenz über die
ökonomischen Auswirkungen der funktionsübergreifenden Investitionen
in Informationstechnologien.
IT-Investitionen haben langfristige Wirkungen: Viele
IT-Investitionen zeichnen sich durch lange Reaktionszeiten
aus, bis die beabsichtigten wirtschaftlichen Effekte wirksam
werden. Die relativ lange Reaktionszeit bis zum vollständigen
Eintritt der Investitionswirkungen stellt ein zentrales Problem
bei der Bewertung von IT-Investitionen dar. Das Problem der
Reaktionszeit bis zum Eintritt der wirtschaftlichen Wirkungen
wächst mit dem Umfang der durch die Implementierung erforderlichen
Reorganisationsmaßnahmen und der Anzahl der betroffenen Fachbereiche
und Geschäftsprozesse.
Warum Schulungen?
Die aufgeführten Problembereiche zeigen, dass die Anforderungen
der IT-Investitionen über die Leistungsfähigkeit der klassischen
Investitionsrechnung hinausgehen. Die traditionellen Investitionsrechenverfahren
stammen historisch gesehen aus dem Industriezeitalter. Die
eingesetzten Maschinen lieferten über ihren Output einen kalkulierbaren
Nutzen bis sie nach Ende ihrer Lebensdauer ausgemustert wurden.
Der betriebswirtschaftliche Nutzen konnte so einfach und unstrittig
über Produktionsauslastungen und Kapazitäten berechnet werden,
oftmals konnten gleichmäßige Auslastungen oder lineare Wertsteigerungen
angenommen werden. Die klassischen Wirtschaftlichkeitsrechnungen
weisen bei der Übertragung auf das Informationszeitalter gravierende
Schwachstellen auf. Die Nutzen der Informationstechnologien
sind nicht mehr deterministisch berechenbar. Es ergeben sich
für die Praxis enorme Probleme bei der Wirtschaftlichkeitsanalyse
von IT-Investitionen. In Kontrast zu dieser realwirtschaftlichen
Problemstellung erfolgt die Diskussion der Leistungsfähigkeit
der klassischen Methoden zur Investitionsrechnung in der Literatur
meistens im Zusammenhang von produktionswirtschaftlichen Anlagen
oder von Finanzinvestitionen, wo die angesprochene Quantifizierungsproblematik
nicht gegeben ist.
Schulungsinhalte
Methoden der Investitionsrechnung und Investitionstheorie
(NPV): Im Bereich der Investitionsrechnung und der Investitionstheorie
werden die bekannten klassischen, statischen und dynamischen
Methoden wie Kapitalwert (Net Present Value (NPV)) und Interner
Zinssatz berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden Methoden,
welche im Bereich der IT-Investitionen selten angewendet werden,
wie die Annuitätenmethode, Kostenvergleichsmethode, Gewinnver-gleichsmethode
und Present Value Index. Zudem werden – wie oben bereits angeführt
– Investitionsprogrammplanungen und Investitionsprogrammentscheidungen,
Ersatzprobleme und Bestimmung der optimalen Nutzungsdauer
aus der Betrachtung ausgeklammert.
Methoden des Controlling (ROI): Die Methoden des Controlling
werden berücksichtigt, soweit sie auf statische und dynamische
Methoden der Investitionsrechnung, wie beispielsweise den
Return on Investment (ROI), zurückgreifen. Ausgegrenzt werden
definitionslogische Systeme des Controllings wie das Du-Pont-Schema
des ROI, welche sich in den Bilanzierungsbereich erstrecken.
Zudem werden viele Methoden des Controlling nicht berücksichtigt,
welche typischerweise auf eine investitionsnachgelagerte Erfolgskontrolle
ausgerichtet sind. Dazu zählen die Methoden des Economic Value
Added, Earned Value Analysis, Shareholder Value Analysis etc.
Methoden der Finanzierung (WACC): Die Methoden der
Finanzierung werden weitgehend ausgegrenzt, da der Finanzierungsfokus
nicht dem betrachteten Problembereich entspricht. Das Konzept
des Weighted Average Cost of Capital wird in Zusammenhang
mit den dynamischen Methoden der Investitionsrechnung zwar
angesprochen, Methoden wie die Vollständige Finanzplanung
(Vofis) werden hingegen nicht betrachtet.
Methoden der Kapitalmarkttheorie (CAPM): Die Methoden der
Kapitalmarkttheorie werden weitgehend ausgegrenzt, weil sie
für den Bereich der IT-Investitionen nur sekundär interessant
sind. Im Bereich der dynamischen Methoden wird auf die methodische
Erweiterung durch das Capital Asset Pricing Modell eingegangen.
Methoden des Chance-Constraint-Programming: Methoden
wie das Chance-Constraint-Programming werden implizit im Bereich
der Realoptionen angesprochen. Standarddiskussionen des Kapitalmarktes
und der Finanzierung wie Separationstheoreme und vollkommener
Kapitalmarkt werden nicht explizit berücksichtigt, da sie
für die Wirtschaftlichkeitsanalyse von IT-Investitionen keine
neuen Erkenntnisse liefern. Methoden der Entscheidungstheorie
(Roll-Back Verfahren): Die Methoden der Entscheidungslehre
werden in der Arbeit angesprochen, sofern sie für die Wirtschaftlichkeitsanaly-se
von IT-Investitionen einsetzbar sind. Dazu zählen die Methoden
der Risikoprämie, die Methode der Sicherheitsäquivalente,
das Entscheidungsbaum- und das Roll-Back Verfahren. Die Konzepte
der beiden letzteren Verfahren werden in Verbindung mit den
binomischen Bäumen aufgeführt.
Methoden der Kostenrechnung (Prozesskostenrechnung): Aus
dem Bereich der Kostenrechnung wird insbesondere auf die Prozesskostenrechnung
bzw. das Activity Based Costing (ABC) eingegangen, da diese
Methodik in der Praxis für die Wirtschaftlichkeitsanalyse
von IT-Investitionen häufig verwendet wird. Andere Ausprägungsformen
der Kostenrechnung werden für den IT-Bereich seltener verwendet
und daher nicht berücksichtigt.
Methoden der Kostenabschätzung (Total Cost of Ownership):
Das Modell des Total Cost of Ownership ist explizit für
die Kostenabschätzung von IT-Investitionen entwickelt worden
und wird daher vorgestellt. Ähnliche Verfahren wie das Real
Cost of Ownership werden wegen der methodischen Analogie nur
genannt, jedoch nicht explizit aufgeführt.
Methoden der Softwareentwicklung (Function Point, COCOMO):
Aus dem Bereich der Softwareentwicklung werden die Function
Point Methode und das Constructive Cost Model berücksichtigt.
Sie stellen die bekanntesten Verfahren zur Abschätzung von
softwareentwicklungs-bezogenen Personalkosten dar. Von der
Darstellung der Weiterentwicklungen dieser Methoden oder sehr
spezialisierten Methoden wird abgesehen.
Methoden der Unternehmensführung (Balanced Scorecard):
Die Balanced Scorecard ist ein weit eingesetztes Instrument
zur Unternehmenssteuerung. Es wird im IT-Bereich oft auch
als Methode zur Wirtschaftlichkeitsanalyse verwendet und daher
im Rahmen des Trainings dargestellt und analysiert.
Methoden des Qualitätsmanagement (EFQM): Aus dem Bereich
des Qualitätsmanagements wird die Methode der European Foundation
for Quality Management (EFQM) dargestellt. Sie wird als qualitative
Bewertungsmethode oft im IT-Bereich eingesetzt. Weitere qualitätsorientierte
Methoden wie das Quality Function Deployment oder das House
of Quality, werden ebenfalls in der Praxis häufig zur Bewertung
eingesetzt, jedoch wird auf diese Methoden wegen der Analogie
zu den Scoring Modellen nicht explizit eingegangen.
Methoden des Performance Management (KPI): Aus dem
Bereich des Performance Managements ist das Konzept der Key
Performance Indicators als Wirtschaftlichkeitsanalyse für
IT-Investitionen in der Praxis sehr beliebt und wird häufig
verwendet. Es wird daher im Rahmen des Workshops vorgestellt.
Methoden der Akzeptanzanalyse (DART): DART ist ein Modell
zur Akzeptanzanalyse von innovativen Technologien. Es wird
im Rahmen der Schulung in Verbindung mit den Key Performance
Indicators als Framework für die qualitative Messung von Kosten
und Nutzeneffek-ten eingesetzt. Weitere Akzeptanzmodelle wie
das Task-Technology-Fit Modell (TTFM) oder das Technology
Acceptance Modell (TAM) eignen sich nicht für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung,
da sie sich eher für die Hypothesenbildung von Kausalzusammenhängen
eignen.
Methoden der Optionspreistheorie (Black-Scholes): Das
Black-Scholes Modell ist das bekannteste Verfahren der Optionspreistheorie
und wird in der Forschung oft zur Bewertung von IT-Investitionen
herangezogen. Neben dem Black-Scholes Modell existieren eine
Vielzahl weiterer Modelle, welche normalerweise aufgrund des
begrenzten Umfangs eines Workshops nur angeführt, aber nicht
ausführlich dargestellt werden. Methoden der numerischen Näherungsverfahren
(Cox-Rubenstein-Ross): Die numerischen Näherungsverfahren
der Optionspreistheorie werden wegen der mathematischen Einfachheit
häufiger eingesetzt als die analytischen Lösungen der Optionspreistheorie.
Das bekannteste Näherungsverfahren ist das Cox-Rubenstein-Ross
Modell, welches über binäre Bäume die Black-Scholes Formel
approximiert. Weitere Verfahren werden aus Kapazitätsgründen
nicht betrachtet.
Methoden der Risikoanalyse: Als Verfahren zur Risikoanalyse
werden in der Literatur oft simulationsbasierte Verfahren
wie Sensitivitätsanalysen und Monte Carlo Simulationen angeführt.
Zudem werden die Amortisationsrechnung, die Methode der Sicherheitsäquivalente
und der Risikoprämien genannt. Diese Methoden werden im Rahmen
der Schulung in Zusammenhang mit anderen Methoden berücksichtigt.
Weiterführende Modelle wie Value at Risk und umfassende Verfahren
des Risikomanagement werden ausgeklammert, da der Bereich
des Risikomanagements in dem Workshop normalerweise aus Kapazitätsgründen
ausgegrenzt wird.
Methoden der Prognose (Monte Carlo Simulationen): Aus
dem Bereich der Prognosemethoden werden im Training nur simulationsbasierte
Verfahren vorgestellt. Die Monte Carlo Simulationen werden
insbesondere im Bereich der realoptionsbasierten Wirtschaftlichkeitsanalysen
häufig eingesetzt. Neuere Entwicklungen, wie die Methoden
des System Dynamics, werden in der Schulung ebenfalls vorgestellt.
Die Methoden, welche in der klassischen Investitionstheorie
oft angewendet werden - wie Zeitreihenanalyse, gleitender
Durchschnitt und exponentielle Glättung - basieren auf der
Auswertung historischer Daten, wie sie im Bereich der IT-Investitionen
nicht zur Verfügung stehen. Eine Vielzahl an Prognosemethoden
ist daher für die Wirtschaftlichkeitsanalyse von IT-Investitionen
nicht einsetzbar. Produktionstheorie und Produktionswirtschaft
(Lernkurven, Erfahrungskurven): In dem Bereich der Produktionstheorie
und der Produktionswirtschaft erscheinen die Konzepte der
Lernkurven und der Erfahrungskurven für die Wirtschaftlichkeitsanalyse
von IT-Investitionen interessant. Es wird im Rahmen des Workshops
diskutiert, ob die Methoden, die im Bereich der Produktionsanlagen
entstanden sind, sich als generelle Wirkungsverläufe auf den
Bereich der IT-Investitionen übertragen lassen.
Methoden des Marketing (Customer Lifetime Value): Aus dem
Bereich des Marketing wird die Methode des Customer Lifetime
Value dargestellt. Andere Methoden des Marketing werden ausgeklammert,
da oft eine monetäre Betrachtung von Wirtschaftlichkeitseffekten
nicht im Vordergrund steht, oder die Anwendung für den Bereich
von IT-Investitionen ungeeignet erscheint.
Methoden der Spieltheorie: Die Methoden der Spieltheorie
werden oft in Verbindung mit Realoptionsmodellen aufgeführt.
Sie werden im Rahmen des Trainings vollständig ausgegrenzt,
da die Verbreitung der spieltheoretischen Ansätze in der Praxis
kaum vorhanden ist.
Methoden des Operations Research und der Linearen Programmierung (MAUT):
Die Methoden des Operation Research und der linearen Programmierung
wie MAUT (Multiattributive Nutzentheorie) und AHP (Analytic
Hierarchy Process) werden ausgeklammert, da die Definition
der zugrunde liegenden Nutzenfunktionen sich für die Praxis
im Bereich der IT-Investitionen als sehr schwierig darstellt.
Die Darstellung der Methoden kann aufgrund der Umfangsbeschränkung
der Arbeit nicht die Detaillierungstiefe einer Einzeldarstellung
erreichen und beschränkt sich auf die für die IT-Investitionen
wesentlichen Bestandteile. Für weitergehende Darstellungen
wird in den einzelnen Kapiteln auf die entsprechende Literatur
verwiesen.
Evaluation Matrix
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse
von IT-Investitionen ist methodisch von folgenden Problemfeldern
gekennzeichnet:
- Die Methoden der klassischen Investitionsrechnung
sind für die Wirtschaftlichkeitsanalyse von IT-Investition
nicht ausreichend.
- Die methodischen Verbesserungen der Realoptionsmodelle
sind für die Bewertung von IT-Investitionen ebenfalls
nicht ausreichend.
- Es sind nur die Kosten einer IT-Investition
mit einer geeigneten Datenqualität monetär messbar.
Eine äquivalente Datenqualität von nutzenorientierten
Methoden existiert nicht.
- Es existiert keine Methode, welche die
Anforderungen für eine Wirtschaftlichkeitsanalyse von
IT-Investitionen vollständig abdeckt.
- Eine Abbildung aller Merkmale einer IT-Investition
ist nur über eine Kombination von Methoden möglich.
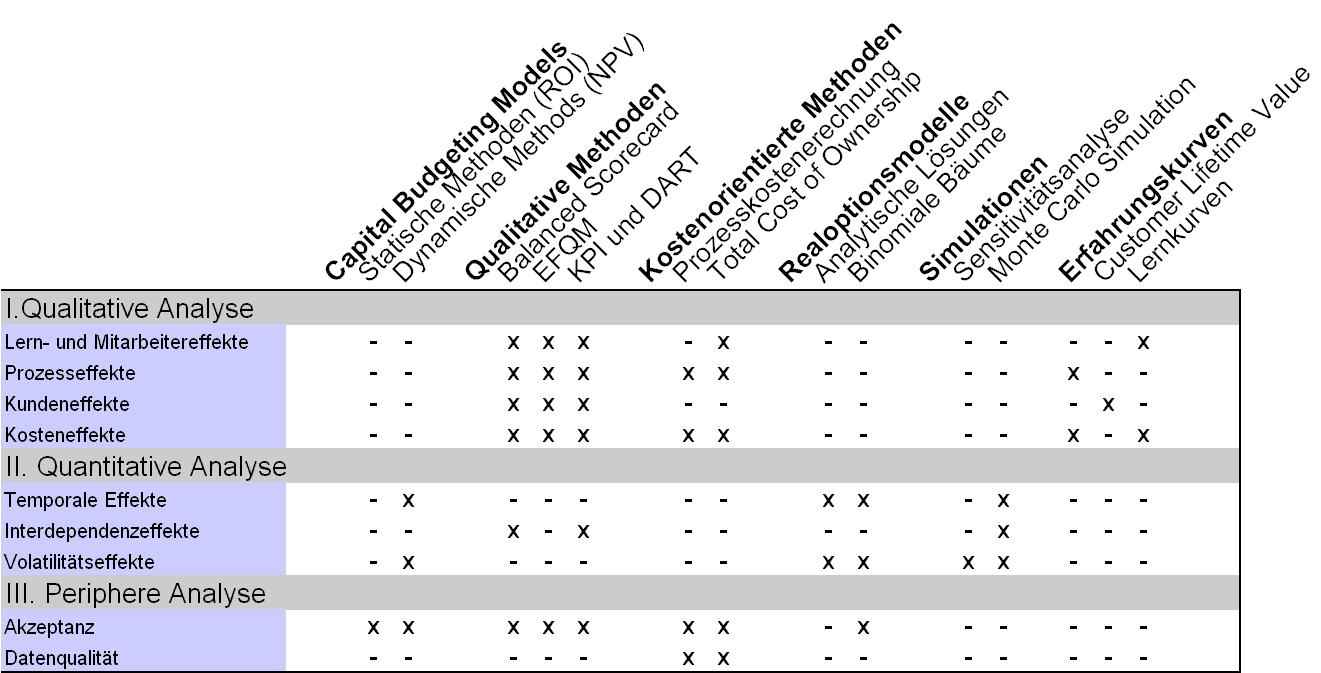
Die Matrix stellt schematisch die Leistungsfähigkeit
und Eignung der Methoden für die Wirtschaftlichkeitsanalyse
von IT-Investitionen dar. Ein Kreuz bedeutet, dass die Methode
in den aufgeführten Bereichen einen positiven Beitrag leisten
kann, ein Minus-Zeichen bedeutet, dass kein Beitrag erkennbar
ist. Anhand der schematischen Darstellung lassen sich folgende
Problembereiche der Wirtschaftlichkeitsanalyse von IT-Investitionen
erkennen:
Capital Budgeting Models (ROI, NPV)
Die statischen und dynamischen
Methoden der Investitionsrechnung bilden die fundamentalen Formeln, welche Kosten und
Nutzen mathematisch in eine Beziehung setzen, um eine Aussage
über die Wirtschaftlichkeit einer Investition entweder
als dimensionslose Kennzahl (ROI, IRR, Rentabilität),
monetären Betrag (NPV, CBA, Kapitalwert) oder als Zeitdauer (Amortisation)
abzubilden. Diese Methoden gehen davon aus, dass die Kosten-
und Nutzeneffekte einer Investition in aggregierter Form und
in monetären Beträgen vorliegen. Methodische Komponenten
zur Quantifizierung der Kosten- und Nutzeneffekte einer IT-Investition
bestehen nicht. Dynamische Methoden erlauben im Vergleich
zu den statischen Methoden, welche nur von kumulierten, periodenbezogenen
oder durchschnittlichen Werten ausgehen, eine zeitdifferenzierte
Betrachtung der anfallenden Kosten- und Nutzeneffekte über
das Konzept der Zahlungsreihe und eine wirtschaftliche Bewertung
der zeitlichen Effekte über die zinsbezogene Diskontierung
der Werte. Modifikationen der dynamischen Methoden erlauben
die Bewertung von Risiko über das CAPM, Risikoprämien
und Sicherheitsäquivalenzen. Obwohl sich die statischen
und dynamischen Methoden im Bereich der IT-Investitionen durch
mangelnde Datenverfügbarkeit und hohe Datenunschärfen
auszeichnen, sind die Methoden in der Praxis sehr beliebt
und allgemein anerkannt.
Qualitative Methoden
Qualitative Methoden erlauben
eine methodische Berücksichtigung aller Kosten- und Nutzeneffekte
einer IT-Investition auf qualitativer Basis. Die Defizite
dieser Methodengruppe sind im quantitativen Bereich zu sehen.
Die Methoden sind zunächst als statische Zeitpunktbetrachtungen
konzipiert und die Bewertung von zeitlichen Effekten und von
Unsicherheit ist nur qualitativ möglich. Einige Methoden
(BSC, KPI und DART) beinhalten methodische Komponenten für
die Berücksichtigung von Interdependenzeffekten durch
Wirkungsketten und Clusteranalysen. Aufgrund der Subjektivität
der Bewertungen ist die Anwendung für eine monetäre
Wirtschaftlichkeitsanalyse methodisch problematisch, obwohl
derartige Beispiele in der Praxis sehr beliebt sind und breite
Akzeptanz finden.
Kostenorientierte Methoden
Die kostenorientierten Methoden
zeichnen sich durch eine einseitige Betrachtung der Kostenseite
von IT-Investitionen aus. Über die Betrachtung von Kosteneinsparungen
liefern die Methoden auch Quantifizierungsbeiträge zu
Mitarbeitereffekten und Prozesseffekten von IT-Investitionen.
Die Prozesskostenrechnung erlaubt, neben der Quantifizierung
von Kosten, auch die Ermittlung von Kosteneinsparungen durch
einen Vergleich der Wirtschaftlichkeit vor und nach der Investitionsmaßnahme.
Aufwandsschätzverfahren (Function Point, COCOMO) können
quantitative Aussagen zu dem notwendigen Personalaufwand bei
IT-Investitionen liefern. Der TCO-Ansatz berücksichtigt
umfassende Kostenkategorien, gibt dabei aber keine Methodik
zur Quantifizierung an. Alle Methoden zeichnen sich dadurch
aus, dass zeitliche Effekte, Interdependenzeffekte und Volatilitätseffekte
nicht abgebildet werden. Die Methoden sind in der Praxis sehr
beliebt und akzeptiert. Die Qualität der Daten hinsichtlich
der Verfügbarkeit und Unschärfen ist bezüglich
der quantifizierten Kosten positiv zu bewerten. Das Defizit
der Methoden ist in der Beschränkung auf die kostenorientierte
Bewertung zu sehen. Die Nutzenseite der IT-Investitionen wird
nicht angesprochen. Die asymmetrische Berücksichtigung
von Kosten und Nutzen bei IT-Investitionen führt zu einer
Verstärkung der Quantifizierungsproblematik.
Realoptionspreismodelle
Die Realoptionspreismodelle
sind hinsichtlich der Anforderungen von IT-Investitionen ähnlich
zu bewerten wie die statischen und dynamischen Methoden. Sie
gehen ebenfalls von bereits quantifizierten Größen
aus. Die Realoptionspreismethoden sind jedoch als methodische
Verbesserung zu werten. Sie ermöglichen die Betrachtung
einer stetigen Verzinsung und eine explizite monetäre
Bewertung von Volatilitätseffekten. Zudem kann über
die Methodik das Potenzial von Folgeinvestitionen monetär
bewertet werden. Dies ist als eine erhebliche methodische
Weiterentwicklung zu werten, insbesondere für die Bewertung
von Infrastrukturinvestitionen und Plattforminvestitionen
im IT-Bereich. Ein Nachteil der Methodik ist in den hohen
mathematischen Anforderungen zu sehen. Die Komplexität
der Modelle wird oft als Black-Box wahrgenommen und den Modellergebnissen
wird entsprechend wenig Vertrauen entgegengebracht. Ein weiteres
Anwendungsproblem ist dadurch gegeben, dass sich viele Modellgrößen
nur über Simulationen bestimmen lassen. Subjektive Abschätzungen
der Werte stellen aufgrund der Datensensitivität der
Ergebnisse keine vernünftige Alternative dar. Die Akzeptanz
der Realoptionsmodelle ist sehr gering. Die Binomischen Bäume
sind bezüglich der Akzeptanz und der Datenqualität
geringfügig positiver zu bewerten, da eine ähnliche
Methodik aus den Entscheidungsbäumen oft bekannt ist
und die Transparenz der Darstellung das Vertrauen in die Daten
und deren Qualität erhöht.
Simulationen
Der Bereich der Simulationen
ist als rein methodischer Bereich zur Modellierung, Quantifizierung
und Prognose von Wertausprägungen zu verstehen. Die Methodik
ist inhaltlich übergreifend zu sehen, die Abbildung von
IT-Investitionen ist nicht vorgesehen. Eine Modellierung von
temporalen Effekten, Interdependenzeffekten und Volatilitätseffekten
ist möglich. Der Nachteile der Methoden sind, dass keine
allgemeingültige Formulierung für eine Wirtschaftlichkeitsanalyse
von IT-Investitionen möglich ist und die Simulation immer
auf einen speziellen Fall spezifiziert werden muss. Derartige
Modelle werden ebenso wie die Realoptionspreismodelle, als
Black-Box wahrgenommen, die Ergebnisse werden entsprechend
wenig akzeptiert. Die Anwendung vieler simulationsbasierter
Modelle ist dadurch eingeschränkt, dass Unklarheiten
über die Modellvariablen und deren Interaktion existieren
und die Verfügbarkeit von Daten nicht gegeben ist.
Erfahrungskurvenmodelle
Erfahrungskurvenmodelle geben
auf der Basis von Erfahrungen Aussagen über typisches
Systemverhalten. Sie finden daher oft Anwendung zur Prognose
und Abschätzung von Kosten- und Nutzenentwicklungen bestimmter
Größen, die in einer Wirtschaftlichkeitsanalyse
eingesetzt werden. Die Lernkurven werden sowohl zur Beschreibung
von Lerneffekten als auch zur Analyse von Kosteneffekten herangezogen.
Kundenlebenszyklusmodelle können zur Abschätzung
von Kundeneffekten benutzt werden, während Erfahrungskurven
zur mathematischen Beschreibung von speziellen Prozesseffekten
eingesetzt werden können. Diese Modelle sprechen jedoch
sehr spezielle Nutzenkategorien an. Die Gültigkeit der
Modellannahmen ist vor dem Einsatz der Methoden im Rahmen
eines bestimmten Anwendungsfalls genau zu überprüfen.
Es sind normalerweise Weiterentwicklungen der Modelle zu leisten,
die mit speziellen Annahmen auf einen Anwendungsfall ausgerichtet
werden. Durch die Anwendungsrestriktionen ergeben sich für
die Grundformen der Methoden eine geringe Akzeptanz und eine
negative Beurteilung der Datenqualität.
Lösungsansätze
Die Matrix erlaubt die Entwicklung von Totalmodellen
(Methodenkombination) und Partialmodellen (Methodenfokussierung)
im Sinne einer Synthese der verschiedenen methodischen Ansätze
und der aufgezeigten Problembereiche:
Strategische Methodenkombinationen
Strategische Methodenkombinationen
versuchen die Gesamtheit an wirtschaftlichen Wirkungen einer
IT-Investition abzudecken. Zielsetzung dieses Ansatzes ist
es, eine Modellkombination zu erarbeiten, die alle relevanten
Merkmale der Investition abbildet. Dies kann durch Kombination
verschiedener Methoden entsprechend ihrer Eignung geschehen.
Eine Auswahl von sinnvollen Kombinationsmöglichkeiten
kann anhand der Entscheidungsmatrix getroffen werden. Es werden
die folgenden Kombinationsmöglichkeiten exemplarisch
an Studien der Unternehmensberatung Cambridge Technology Partners
aufgeführt:
Dynamisierungen des
ROI
Dynamisierungen des ROI: Eine Kombination aus statischen ROI Methoden, Lernkurven
und Kundenlebenszyklusmodellen wurden für IT-Investitionen
in der Studie: „Time to ROI – Wirtschaftlichkeitsberechnungen
von CRM-Systemen in der Versicherungsbranche“ vorgestellt.
Die Studie baut methodisch auf einer Dynamisierung des
statischen ROI auf. In die Berechnungen werden Kundeneffekte
und Lerneffekte angesprochen. Die Kundeneffekte werden
über den Kundenwertlebenszyklus und über Lernkurven
abgebildet.
Ganzheitliche Kombinationen
Ganzheitliche Kombinationen:
Eine weitere Möglichkeit, die Methoden für IT-Investitionen
ganzheitlich zu kombinieren, wird beispielsweise in der
Studie „Time to ROI II -Wirtschaftlichkeitsberechnungen
von CRM-Projekten in der Kreditwirtschaft“ durchgeführt.
Die Studie verfolgt einen umfassenden Ansatz zur Nutzenmessung
und berücksichtigt explizit Kundeneffekte, Mitarbeitereffekte,
Folgeinvestitionen und Prozesseffekte. Die Kundeneffekte
werden in dieser Studie über den Customer Lifetime
Value berechnet, analog wird für die Mitarbeitereffekte
das Konzept eines Employee Lifetime Value zur Berechnung
konstruiert. Die Nutzenkomponenten von Folgeinvestitionen
werden über Binomische Bäume quantifiziert und
die Prozesseffekte werden über eine Prozesskostenrechnung
hergeleitet. Entsprechend der Entscheidungsmatrix ist
zu erkennen, dass in dieser Kombination alle wirtschaftlichen
Wirkungskategorien einer IT-Investition angesprochen werden.
Total Benefit of Ownership
Total Benefit of Ownership:
Als ein weiteres Beispiel für eine sinnvolle Kombinationsmöglichkeit
von Methoden kann die Studie „Time to ROI III -
Nutzenmessung von Kundenportalen bei Energieversorgungsunternehmen“
gesehen werden. Die Studie vergleicht qualitative und
quantitative Analysemethoden miteinander. Die qualitative
Wirtschaftlichkeitsanalyse basiert auf Key Performance
Indicators in Verbindung mit DART. Zur quantitativen Wirtschaftlichkeitsrechnung
wird ein Modell des Total Benefit of Ownership und Total
Cost of Ownership verbunden. Das Konzept des Total Benefit
of Ownership ist hierbei durch die Kombination von Monte
Carlo Simulationen und verschiedenen Erfahrungskurven
realisiert.
Derartige Kombinationsmöglichkeiten sagen
noch nichts über die Qualität der Totalmodelle und
der zugrunde gelegten Berechnungen aus. Sie können keine
Sicherheit für die Richtigkeit und Qualität der
Modellierung liefern, geben aber Anhaltspunkte für theoretisch
sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten.
Strategische Methodenfokussierung (Partialmodelle)
Unter dem Begriff Partialmodell
werden Modelle verstanden, welche nur einen bestimmten wirtschaftlichen
Aspekt einer IT-Investition bei der Berechnung in den Vordergrund
stellen. Bei vielen IT-Investitionen steht eine Verknüpfung
von Strategie und Investition im Vordergrund. Entsprechend
der strategischen Grundausrichtung ist eine Fokussierung der
Wirtschaftlichkeitsanalyse auf bestimmte Nutzeneffekte möglich.
Dabei wird angenommen, dass die wirtschaftlichen Effekte primär
in der strategischen Ausrichtung der Investition zu finden
sein müssen und dass von weiteren Effekten abstrahiert
werden kann. Für eine angemessene Bewertung müssen
bei diesem Ansatz der Bewertungsschwerpunkt der Methode und
der Nutzenschwerpunkt der Investition übereinstimmen.
Es ist eine Auswahl der Methoden in Abhängigkeit von
dem strategischen Fokus der Investition über die Entscheidungsmatrix
notwenig:
Kostenführerschaft IT-Investitionen mit der strategischen Ausrichtung der
Kostenführerschaft suchen den Nutzen von IT-Investitionen
hauptsächlich in Prozesseffekten und Kosteneffekten,
wie beispielsweise Produktivitätssteigerungen und
Effizienzsteigerungen. Aus dem Entscheidungsraster ist
ersichtlich, dass für derartige Investitionen eine
Wirtschaftlichkeitsanalyse auf Basis der Prozesskostenrechnung
sinnvoll ist. In diesen Bereich fallen auch oft Rationalisierungsinvestitionen.
Qualitätsverbesserung
IT-Investitionen mit der strategischen Ausrichtung der
Qualitätsverbesserung legen den Fokus typischerweise
weniger auf Kosteneffizienz sondern versuchen ganzheitlich
die Qualität durch Steigerung von Lerneffekten, Mitarbeiterqualitäten
und Prozessqualitäten zu verbessern. Aus dem Raster
ist ablesbar, dass sich für derartige IT-Investitionen
Modelle wie die Balanced Scorecard oder das EFQM eignen.
Kundenorientierung
IT-Investitionen mit strategischer Kundenausrichtung werden
im IT-Bereich durch Customer Relationship Management (CRM)
Systeme realisiert. In diesem Bereich werden insbesondere
Kundeneffekte in den Vordergrund gestellt. Anhand des
Entscheidungsrasters ist ersichtlich, dass in der Analyse
für diesen Bereich entweder qualitative Methoden
oder methodische Kombination mit dem Customer Lifetime
Value Modell positiv bewertet wurden.
Flexibilität IT-Investitionen, mit denen
als strategische Zielsetzung angestrebt wird, eine höhere
organisatorische Flexibilität und erweiterte Handlungsspielräume
des Unternehmens zu erreichen, sind auf eine monetäre
Bewertung von temporalen Effekten und Volatilitätseffekten
angewiesen. In der Entscheidungsmatrix ist ersichtlich,
dass derartige Bewertungen nur über Realoptionsmodelle
oder Simulationen gewährleistet werden können.
In diesen Bereich fallen oft Plattforminvestitionen und
Infrastrukturinvestitionen an.Kompetenzmanagement
Der Fokus von IT-Investitionen, deren strategische Zielsetzung
das Management und die Verwaltung von Kompetenzen, Rechten
oder Lizenzen ist, liegt auf Prozesseffekten und Kosteneinsparungen,
so dass Prozesskostenrechnungen geeignet sind. Werden
unternehmensübergreifende Wertschöpfungsnetze
beurteilt, so ist wegen der Vielzahl an Wirkungen und
Merkmalen der Einsatz qualitativer Methoden, wie beispielsweise
Key Performance Indicators mit dem DART-Framework, zu
erwägen.
|

